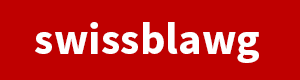News
Urteil B‑2334/2023: Rechtswidrige Verfügung zur Abschreibung von AT1-Kapitalinstrumenten
Urteil B‑2334/2023: Rechtswidrige Verfügung zur Abschreibung von AT1-Kapitalinstrumenten
von Dominic Wälchli am 27. Oktober 2025
Im Teilentscheid B‑2334/2023 vom 1. Oktober 2025 hob das Bundesverwaltungsgericht die Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht vom 19. März 2023, mit welcher diese die Credit Suisse Group AG angewiesen hatte, ihre Additional Tier 1‑Kapitalinstrumente abzuschreiben, mangels Rechtsgrundlage auf.
Hintergrund des Teilentscheids war die von X. S.L., Y. S.L. und Z. S.L. (Beschwerdeführende) eingereichte Beschwerde vom 27. April 2023 gegen die Verfügung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA oder hier auch Vorinstanz) vom 19. März 2023 (Verfügung) (sowie mittels Beschwerdeergänzung vom 15. Mai 2023 auch gegen die FINMA-Verfügung vom 22. März 2023, soweit diese die Verfügung bestätigte).
In dieser Verfügung wies die FINMA die Credit Suisse Group AG (CS) an, die AT1-Kapitalinstrumente vor dem Hintergrund des am 19. März 2023 kommunizierten Massnahmenpakets zur Übernahme der CS durch die UBS Group AG (Beschwerdegegnerin) abzuschreiben. Die FINMA stützte sich für den Erlass der Verfügung auf aArt. 5a der Verordnung über zusätzliche Liquiditätshilfe-Darlehen und die Gewährung von Ausfallgarantien des Bundes für Liquiditätshilfe-Darlehen der Schweizerischen Nationalbank an systemrelevante Banken vom 16. März 2023 (PLB-NVO).
Die Beschwerdeführenden verlangten unter anderem die Aufhebung der Verfügung und die Verpflichtung der CS, die vollständige Abschreibung der relevanten AT1-Kapitalinstrumente (namentlich die USD 1’500’000’000 4.500 Per Cent Perpetual Tier 1 Contingent Write-down Capital Notes) rückgängig zu machen. Im Rahmen des Teilentscheids befasste sich das Bundesverwaltungsgericht nur mit dem Antrag der Beschwerdeführenden, die Verfügung aufzuheben (E. 1).
Nachdem das Bundesverwaltungsgericht seine Zuständigkeit (E. 2 ff.) und die Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführenden (E. 3 ff.) bejaht hatte, befasste es sich in materieller Hinsicht mit der Frage, ob die Voraussetzungen für einen sogenannten Viability Event (Klausel Ziff. 7(a)(iii) der AT1-Vertragsbedingungen) erfüllt gewesen waren (E. 5 ff.).
Zur Beurteilung dieser Frage legte das Bundesverwaltungsgericht die AT1-Vertragsbedingungen, welche die relevanten Viability Events (Viability Event Typ A und Viability Event Typ B) definierten, gemäss zivilrechtlichen Grundsätzen aus, wobei es sich primär auf den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien stützte (E. 5.4.1), aber auch gemäss Vertrauensprinzip zu keinem abweichenden Auslegungsergebnis kam (E. 5.4.2). Das Bundesverwaltungsgericht kam zum Schluss, dass nach dem übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien ein Viability Event Typ B vorgelegen habe, wenn die in Frage stehende Staatshilfe bestimmt und erforderlich gewesen seien, um eine ungenügende Eigenkapitalausstattung zu verbessern (E. 5.4.2 / E. 5.4.4.4)). Für das Bundesverwaltungsgericht war es sodann nicht erwiesen, dass die in Frage stehenden Staatshilfen bestimmt und erforderlich gewesen seien, um die Eigenkapitalausstattung der CS zu verbessen (auch nicht indirekt) (E. 5.4.5 ff). Entsprechend habe kein Viability Event Tyb B vorgelegen (E. 5.4.8).
Für den Viability Event Typ A kam das Bundesverwaltungsgericht zum gleichen Auslegungsergebnis (E. 5.5.1 ff.) und ergänzte, dass weder die Vorinstanz noch die Beschwerdegegnerin belegt gehabt habe, dass eine für den Viability Event Typ A relevante Mitteilung der FINMA erfolgt gewesen sei (E. 5.5.5.1). Zudem sei zum relevanten Zeitpunkt unbestrittenermassen ein T2-Instrument ausstehend gewesen (E. 5.5.5.2). Es kam somit zum Schluss, dass auch die Voraussetzungen für den Eintritt des Viability Events Typ A nicht gegeben gewesen seien (E. 5.5.9).
In einem zweiten Schritt beurteilte das Bundesverwaltungsgericht, ob die Anweisung der Vorinstanz in die verfassungsmässig garantierte Eigentumsgarantie der Beschwerdeführenden eingegriffen hatte.
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass die Eigentumsgarantie gemäss Art. 26 der Bundesverfassung (BV) auch andere vermögenswerte Rechte wie obligatorische Rechte schütze, womit auch die AT1-Anleihen in den Schutzbereich der Eigentumsgarantie fallen würden (E. 6.2). Sodann prüfte das Bundesverwaltungsgericht, ob die Voraussetzung einer gesetzlichen Grundlage gemäss Art. 36 BV für einen rechtmässigen Eingriff in die Eigentumsgarantie erfüllt war. Aufgrund der in Frage stehenden Beträge ging das Bundesverwaltungsgericht davon aus, dass es sich um einen schweren Eingriff gehandelt habe, womit eine ausdrückliche Regelung in einem formellen Gesetz notwendig gewesen wäre (E. 6.4 ff.).
Eine solche Grundlage in einem formellen Gesetz lag nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht hielt zu Art. 26 BankG fest, dass der Handlungsspielraum der FINMA zum Erlass von Massnahmen unter dieser Bestimmung gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung beschränkt gewesen sei (E. 6.8.3). Insbesondere müssten sich solche Massnahmen primär gegen die beaufsichtigte Bank und nur punktuell sowie indirekt gegen deren Kunden richten (E. 6.8.3 f.). Zudem handle es sich bei diesen Schutzmassnahmen lediglich um vorsorgliche Massnahmen mit vorläufigem Charakter (E. 6.8.5). Diese Voraussetzungen seien im Zusammenhang mit der Anweisung zur Abschreibung der AT1-Kapitalinstrumente gerade nicht erfüllt gewesen (E. 6.8.6.2), weshalb Art. 26 BankG nicht als genügende gesetzliche Grundlage diene (E. 6.8.7).
Zu Art. 31 Abs. 1 FINMAG hielt das Bundesverwaltungsgericht fest, dass diese Bestimmung die FINMA zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustands ermächtige, wenn ein Beaufsichtigter Bestimmungen eines Finanzmarktgesetzes verletzt habe oder sonstige Missstände bestehen würden. Auch hier gelte, dass nicht jede Massnahme zulässig sei: Sie müsse sich gegen die Bank richten und dürfe Kunden nur mittelbar betreffen (E. 6.9.2), was vorliegend wie im Zusammenhang mit Art. 26 BankG ausgeführt worden sei, gerade nicht der Fall gewesen sei (E. 6.9.3).
Betreffend Art. 5a PLB-NVO war das Bundesverwaltungsgericht der Meinung, dass dies Bestimmung ebenfalls nicht genügt habe, da es sich nicht um ein Gesetz im formellen Sinne gehandelt habe. Somit könne diese Bestimmung nicht als Grundlage für einen schweren Eingriff in die Eigentumsgarantie gedient haben (E. 6.10.2). Zudem habe Art. 5a PLB-NVO die Anforderungen an eine gesetzliche Grundlage gemäss Art. 36 Abs. 1 BV generell nicht erfüllt, da diese Bestimmung zu unbestimmt gewesen sei (E. 6.10.3 f.).
Schliesslich hielt das Bundesverwaltungsgericht auch fest, dass Art. 5a PLB-NVO nicht verfassungskonform gewesen sei, da die Voraussetzungen für den Erlass einer Notverordnung nach Art. 184 Abs. 3 bzw. Art. 185 Abs. 3 BV u.a. mangels fehlender Subsidiarität nicht erfüllt gewesen seien (E. 7.2 ff). Weiter seien auch die Anforderungen an die Übertragung von Verwaltungsaufgaben mit Enteignungsbefugnissen an Private gemäss Art. 178 Abs. 3 BV nicht erfüllt gewesen (E. 7.9 ff).
Da Art. 5a PLB-NVO somit verfassungswidrig war, konnte diese Bestimmung ebenfalls nicht als Rechtsgrundlage für die Anweisung der FINMA zur Abschreibung der AT1-Kapitalinstrumente dienen (E. 7.11).
Die AT1-Verfügung wurde somit als rechtswidrig eingestuft, womit der Antrag der Beschwerdeführenden gutgeheissen und die Verfügung aufgehoben wurde (vgl. E. 10).
4A_221/2025: Anspruch auf Lohnfortzahlung bei Suchterkrankung (amtl. Publ.)
4A_221/2025: Anspruch auf Lohnfortzahlung bei Suchterkrankung (amtl. Publ.)
von Patricia Meier am 26. Oktober 2025
Im zur Publikation vorgesehenen Urteil 4A_221/2025 vom 11. September 2025 befasste sich das Bundesgericht mit der Frage, ob ein an einer Alkoholabhängigkeit erkrankter Arbeitnehmer nach einem Führerausweisentzug Anspruch auf Lohnfortzahlung gestützt auf Art. 324a Abs. 1 OR habe. Im Kern ging es um die Frage, ob eine selbstverschuldete Arbeitsverhinderung dem Anspruch auf Lohnfortzahlung entgegensteht, wenn gleichzeitig eine unverschuldete Verhinderung an der Arbeitsleistung vorliegt.
Der Arbeitnehmer (Beschwerdegegner) mit Funktion als Servicetechniker im Aussendienst hatte am 25. September 2022 mit 1,9 Promille Blutalkoholgehalt einen Verkehrsunfall verursacht, welcher zum sofortigen Führerausweisentzug und Verurteilung durch die Staatsanwaltschaft geführt hatte. Von Ende September 2022 bis Ende Januar 2023 war er infolge diagnostizierter Alkoholabhängigkeit samt teils stationären Behandlung zu 100% arbeitsunfähig. Das Arbeitsverhältnis wurde auf Wunsch des Arbeitnehmers mit Aufhebungsvereinbarung vom 25. Januar 2023 aufgehoben. Der Beschwerdegegner forderte von der Arbeitgeberin (Beschwerdeführerin) klageweise ausstehende Lohnzahlungen seit 15. Dezember 2022 nebst Zins zu 5%, welche ihm das erstinstanzliche Gericht ab 16. Dezember 2022 nebst Zins zu 5% zusprach. Das Urteil wurde zweitinstanzlich bestätigt.
Hinsichtlich des strittigen Lohnfortzahlungsanspruchs erwog das Bundesgericht, dass die Vorinstanzen von einer im Unfallzeitpunkt weit fortgeschrittenen Suchterkrankung ausgegangen seien. Die unfallverursachende Fahrt sei nicht vergleichbar mit derjenigen einer nicht alkoholabhängigen Person, die stark alkoholisiert ein Fahrzeug führe (E. 2.1), Bei Letzterer wäre ein Verschulden klarerweise zu bejahen. Vorliegend sei auch zuständige Arzt davon ausgegangen, dass der Beschweredegegner infolge der Suchterkrankung zum Unfallzeitpunkt nicht mehr in der Lage gewesen sei, sein Verhalten zu kontrollieren und habe deshalb aufgrund von Selbst- und Fremdgefährdung eine fürsorgerische Unterbringung angeordnet. Somit sei der Unfall bzw. der nachfolgende Führerausweisentzug eine Folge der schon länger bestehenden unverschuldeten Suchterkrankung. Selbst wenn der Führerausweisentzug als selbstverschuldet zu betrachten wäre, bliebe es bei der Krankschreibung ab dem 26. September 2022 infolge der Alkoholabhängigkeit mit stationärer Behandlung.
Gemäss den Ausführungen der Vorinstanz könne für eine Lohnfortzahlungspflicht nach Art. 324a OR nicht verlangt werden, dass kumulativ sämtliche Arbeitsverhinderungen unverschuldet sein müssten, wenn der unverschuldete Grund bereits kausal für die Hinderung an der Arbeitsleistung sei, auch wenn gleichzeitig eine verschuldeter Grund vorliege. Eine derart strenge Auslegung würde der Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin widersprechen (E. 2.1).
Die Beschwerdeführerin habe demgegenüber vorgebracht, dass vorliegend der Beschwerdegegner zwar krankheitsbedingt an der Erbringung der Arbeitsleistung verhindert gewesen sei, gleichzeitig jedoch auch, weil er wissentlich und willentlich alkoholisiert ein Motorfahrzeug gelenkt habe und ihm infolgedessen der für die Arbeitsausübung erforderliche Führerausweis entzogen worden sei. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin vermöge eine unverschuldete Verhinderung an der Arbeitsleistung eine verschuldete Arbeitsverhinderung nicht zu heilen (E. 2.2).
Dazu erwog das Bundesgericht, dass der Anspruch auf Lohnfortzahlung nach Art. 324a Abs. 1 OR voraussetze, dass der Arbeitnehmer aus Gründen, die in seiner Person liegen unverschuldet an der Arbeitsleistung verhindert sei; d.h. Krankheit, Unfall, Erfüllung gesetzlicher Pflichten etc. Eine solche Arbeitsverhinderung könne sich auch aus äusseren Umständen ergeben, etwa durch fürsorgerische Unterbringung oder angeordnete Untersuchungshaft, sofern dem Arbeitnehmer kein Verschulden vorgeworfen werden könne (E. 2.3.1; Gegenteiliges gelte jedoch i.d.R. im Falle einer Verurteilung: BGE 114 II 274 E. 5).
Vorliegend bilde nicht die aus der Krankheit resultierende gesundheitliche Beeinträchtigung an sich die Voraussetzung für den Anspruch auf Lohnfortzahlung, sondern die daraus resultierende Arbeitsunfähigkeit bzw. Unzumutbarkeit der Fortsetzung der Arbeit. Erforderlich sei ein Kausalzusammenhang zwischen der krankheitsbedingten Beeinträchtigung und der Arbeitsunfähigkeit. Anders als im Sozialversicherungsrecht, so das Bundesgericht, werde im privaten Arbeitsrecht für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit nicht auf die Fähigkeit abgestellt, im bisherigen Beruf zumutbare Arbeit zu leisten. Im Anwendungsbereich von Art. 324a OR sei vielmehr in erster Linie der Inhalt der vertraglichen Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber massgebend (E. 2.3.1).
Die Frage, ob eine Arbeitsverhinderung infolge von Alkohol- oder Drogensucht als unverschuldet zu betrachten sei, müsse im Einzelfall beurteilt werden, hielt das Bundesgericht weiter fest. Gleite jemand über längere Zeit gleichsam unmerklich in eine immer tiefer werdende Abhängigkeit ab, sei grundsätzlich von fehlendem Verschulden auszugehen. Im konkreten Fall sei zu Recht unstrittig, dass es sich bei der Alkoholsucht des Beschwerdegegners um eine Krankheit handle.
Weiter erwog das Bundesgericht, dass die Leistungspflicht nach Art. 324a OR in jedem Fall einen natürlichen Kausalzusammenhang zwischen dem unverschuldeten Verhinderungsgrund und dem Ausbleiben der Arbeitsleistung voraussetze. Dies seien alle Umstände, ohne deren Vorhandensein der eingetretene Erfolg nicht als eingetreten oder nicht als in der gleichen Weise bzw. zur gleichen Zeit eingetreten gedacht werden könne. Demgemäss sei für die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhangs nicht erforderlich, dass die Krankheit die alleinige oder unmittelbare Ursache der Arbeitsverhinderung sei; es genüge, dass sie zusammen mit anderen Bedingungen den Arbeitnehmer an der Leistungserbringung gehindert habe, d.h. nicht weggedacht werden könne, ohne dass auch die eingetretene Arbeitsverhinderung entfiele (E. 2.3.2).
Lägen mehrere Gründe für eine Arbeitsverhinderung vor, so sei pro Zeitperiode zu beurteilen, aus welchem Grund der Arbeitnehmer an der Arbeitsleistung verhindert sei und ob der jeweilige Grund verschuldet oder unverschuldet sei. Könne beispielsweise eine Person infolge Verbüssung einer Freiheitsstrafe nicht zur Arbeit erscheinen, stehe ihr zufolge Verschuldens kein Anspruch auf Lohnfortzahlung zu. Erkranke sie nach Antritt des Strafvollzugs, ändere die (unverschuldete) Krankheit nichts an der verschuldeten Arbeitsverhinderung. Entsprechend könne der Lohnfortzahlungsanspruch nicht während des Strafvollzugs infolge Krankheit wieder aufleben. Ein Anspruch auf Lohnfortzahlung würde hingegen nachträglich entstehen, wenn die Person bei andauernder Krankheit aus dem Strafvollzug entlassen würde, da sie ab diesem Zeitpunkt aufgrund Krankheit an der Arbeitsleistung gehindert wäre (E. 2.3.3).
Vorliegend, erwog das Bundesgericht, lägen jedoch keine solchen sich überlagernden und unabhängig voneinander bestehenden Gründe für eine Arbeitsverhinderung vor. Ohne die fortgeschrittene Alkoholsucht des Beschwerdegegners wäre es nicht zum Verkehrsunfall mit anschliessender fürsorgerischer Unterbringung und stationärer Behandlung des Arbeitnehmers gekommen. Der Führerausweisentzug habe nichts an der bereits bestehenden Arbeitsverhinderung infolge Krankheit samt stationärer medizinischer Behandlung geändert. Der Verkehrsunfall, die fürsorgerische Unterbringung sowie der Führerausweisentzug seien allesamt verschiedene Manifestationen der schweren Alkoholsucht, somit ein und derselben Ursache. Demnach sei der Führerausweisentzug nicht ein für sich bestehender unabhängiger Grund für die Arbeitsverhinderung, sondern lediglich ein weiteres Glied in der Kausalkette. Der Beschwerdegegner sei primär infolge Krankheit und der medizinischen Einweisung mit stationärer Behandlung an der Arbeit verhindert und nicht erst zufolge Führerausweisentzugs. Demnach sei der Krankheitszustand des Arbeitnehmers die ursprüngliche und primäre Ursache der Arbeitsverhinderung und nicht der Entzug des für die Tätigkeit des Servicetechnikers vorausgesetzten Führerausweises. Es brauche daher nicht vertieft zu werden, ob der Führerausweisentzug für sich allein genommen als Arbeitsverhinderung im Sinne von Art. 324a Abs. 1 OR zu betrachten wäre (E. 2.3.4).
Infolgedessen kam das Bundesgericht zum Schluss, dass die Vorinstanz Art. 324a Abs. 1 nicht verletzte, indem sie von einer krankheitsbedingten Verhinderung an der Arbeitsleistung ausgegangen sei und demgemäss eine Lohnfortzahlungspflicht bejaht habe (E. 2.3.5).
5A_384/2024: Überschussanteil des Kindes unverheirateter Eltern bei alternierender Obhut (amtl. Publ.)
5A_384/2024: Überschussanteil des Kindes unverheirateter Eltern bei alternierender Obhut (amtl. Publ.)
von Jean-Michel Ludin am 25. Oktober 2025
Im zur amtlichen Publikation vorgesehenen Urteil 5A_384/2024 vom 10. September 2025 befasste sich das Bundesgericht mit der Berechnung des Überschussanteils von Kindern unverheirateter Eltern bei alternierender Obhut. Es kommt zum Schluss, dass sich der Überschussanteil diesfalls gleich berechnet wie bei Kindern von verheirateten Eltern.
Zusammenfassung
Die Parteien des vorliegenden Verfahrens sind die unverheirateten Eltern zweier Kinder, welche sie hälftig alternierend betreuen. Vor Bundesgericht war unter anderem umstritten, wie sich der Überschussanteil der Kinder berechnet.
Das Bundesgericht hält vorab fest, dass die Kinder Anspruch darauf haben, am Gesamtüberschuss beider Elternteile zu partizipieren, da zufolge der alternierenden Obhut beide Elternteile für den Barunterhalt ihrer Kinder verantwortlich seien (E. 5.4.1).
Beim Frage nach dem Verteilschlüssel für den Überschuss seien zwei Varianten denkbar:
Entweder berechne man den Überschussanteil global, wie bei verheirateten Eltern und Teile den Gesamtüberschuss nach grossen und kleinen Köpfen auf. Der Anteil des Kindes entspreche einem “kleinen Kopf”-Anteil am Familienüberschuss, womit bei zwei Kindern diese jeweils Anspruch auf 1/6 des Gesamtüberschusses hätten. Der virtuelle Anteil des anderen Elternteils — der keinen Unterhaltsanspruch habe — verbleibe beim unterhaltspflichtigen Elternteil.
Alternativ sei es denkbar, der den Kindern zustehende Überschussanteil getrennt für jeden Elternteil zu berechnen. In diesem Fall würde der Überschuss jedes Elternteils separat berücksichtigt und ein Teil davon nach dem Prinzip “ein grosser Kopf und so viele kleine Köpfe, wie es Kinder gibt” den Kindern zugewiesen. Bei zwei Kindern würde dies bedeuten, dass diese jeweils einen Anspruch auf 1/4 des Überschusses der Mutter und 1/4 des Überschusses des Vaters hätten.
Das Bundesgericht gibt in der Folge der ersten Lösungsvariante den Vorzug. Es seien keine triftigen Gründe erkennbar, die eine unterschiedliche Behandlung des Kindes je nach Familienstand seiner Eltern rechtfertigen würden. Es bestehe auch keine Gefahr einer indirekten Subventionierung des anderen Elternteils, da der virtuelle Überschussanteil, der für den anderen Elternteil berechnet wird, beim unterhaltspflichtigen Elternteil verbleibe. Zudem verringere die Berücksichtigung von zwei grossen Köpfen indirekt den Anteil der Kinder (E. 5.4.2).
Kommentar
Das bundesgerichtliche Urteil behandelt eine in der Lehre bislang umstrittene Frage und markiert damit einen weiteren Schritt auf dem Weg zur vom Bundesgericht angestrebten schweizweiten Vereinheitlichung der Unterhaltsberechnung.
Ohne Weiteres zuzustimmen ist dem Urteil, soweit es festhält, dass Kinder unverheirateter Eltern bei alternierender Obhut Anspruch darauf haben, am Überschuss beider Elternteile zu partizipieren. Dies im Unterschied zu Kindern unverheirateter Eltern, die unter der Alleinobhut eines Elternteils stehen. Diesfalls partizipieren die Kinder einzig am Überschuss des nichtobhutsberechtigen Elternteils.
Betreffend den Verteilschlüssel wäre es angesichts der in BGE 149 III 441 begründeten und in diesem Blog begrüssten Rechtsprechung konsequent gewesen, den Überschussanteil der Kinder für jeden Elternteil separat zu berechnen. Im genannten Leiturteil hielt das Bundesgericht für Kinder unverheirateter Eltern, die unter der Alleinobhut stehen, fest, dass für den unterhaltsansprechenden Elternteil kein virtueller Überschussanteil auszuscheiden sei. Nach vorliegender Ansicht scheint das auch bei alternierender Obhut nicht opportun. Es ist generell darauf zu verzichten, virtuelle Überschussanteile auszuscheiden. So wäre es auch im Rahmen einer Scheidung für die Berechnung des Überschussanteils der Kinder angezeigt, analog BGE 149 III 441 vorzugehen, wenn der unterhaltsberechtigte Ehegatte keinen Anspruch auf nachehelichen Unterhalt hat.
Dass Kinder unverheirateter Eltern einen höheren Überschussanteil erhalten als Kinder verheirateter Eltern, lässt sich sachlich begründen, da der unterhaltspflichtige Elternteil von Kindern unverheirateten Eltern den Überschuss einzig mit den Kindern und nicht noch mit dem anderen Elternteil zu teilen hat. Er verfügt damit über eine höhere Leistungsfähigkeit, was die unterschiedliche Berechnung des Überschussanteils rechtfertigt.
2C_657/2023: Anfechtungsobjekte im Einladungsverfahren (Submissionsrecht; zur Publikation vorgesehen)
2C_657/2023: Anfechtungsobjekte im Einladungsverfahren (Submissionsrecht; zur Publikation vorgesehen)
von Jamie Lee Mancini am 23. Oktober 2025
Im Entscheid 2C_657/2023 vom 4. September behandelte das Bundesgericht die Frage, ob Anbieterinnen im Einladungsverfahren Ausschreibungsunterlagen selbständig anfechten können bzw. müssen.
Sachverhalt
Die Gemeinde Surses (Vergabebehörde) kündigte am 20. April 2023 in einer Lokalzeitung die Vergabe von Winterdienstarbeiten für fünf Jahre an. In den Ausschreibungsunterlagen, die bei der Vergabebehörde bezogen werden konnten, wurde das Einladungsverfahren für massgebend erklärt. Als Zuschlagskriterien legte die Vergabebehörde die Qualität der Anbieterin (40 %), die Qualität des Angebots (30 %) sowie den Preis (30 %) fest.
Mit Einladung vom 26. April 2023 lud die Vergabebehörde unter anderem die A. SA (Beschwerdeführerin) zur Offerteinreichung ein. Innert Frist reichten unter anderem die B. AG (Beschwerdegegnerin) und die Beschwerdeführerin ein Angebot ein. Der Zuschlag wurde der Beschwerdegegnerin erteilt.
Gegen den Zuschlag erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden (Vorinstanz). Sie begründete ihre Beschwerde namentlich damit, dass die Vergabebehörde den Preis mit 30 % unter der rechtlich zulässigen Mindestgewichtung von 60 % für die vorliegend standardisierte Vergabe gewichtet habe. Die Vorinstanz wies die Beschwerde ab, wogegen die Beschwerdeführerin an das Bundesgericht gelangte.
Erwägungen
Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, die Rüge betreffend falscher Gewichtung des Zuschlagskriteriums “Preis” sei verspätet erfolgt. Die Anordnungen in den Ausschreibungsunterlagen müssten auch im Rahmen des Einladungsverfahrens zusammen mit der Ausschreibung angefochten werden.
Diese Ansicht stützte das Bundesgericht nicht: Es hielt fest, dass das Einladungsverfahren ohne Ausschreibung eingeleitet werde: «Das Einladungsverfahren zeichnet sich gemäss Art. 20 Abs. 2 IVöB dadurch aus, dass die Vergabebehörde zwar Ausschreibungsunterlagen im Sinne von Art. 36 IVöB erstellt (Satz 2), aber keine Ausschreibung veröffentlicht (Satz 1)». Anstelle der Ausschreibung trete die Einladung zur Offertstellung (E. 3.2.1).
Das Bundesgericht verwies auf die herrschende Lehre, wonach diese Einladung zur Offertstellung nicht unter den Begriff der Ausschreibung i.S.v. Art. 53 Abs. 1 lit. a IVöB subsummiert werden könne und folgte dieser Ansicht: Der Begriff der Ausschreibung beziehe sich auf die im offenen und selektiven Verfahren zwingend zu publizierende Ausschreibung (vgl. Art. 48 Abs. 1 IVöB). Im Einladungsverfahren bestehe demgegenüber für eine Ausschreibung – deren Mindestinhalt aus Art. 35 IVöB hervorgeht – kein Raum. Die Einladung zur Offerststellung stelle keine anfechtbare Ausschreibung dar, womit, mangels Beschwerdeobjekt, die zum Angebot eingeladenen Anbieterinnen somit auch nicht gegen die Einladung zur Offertstellung vorgehen könnten (E. 3.2.2). Zumal Art. 53 Abs. 1 IVöB einen abschliessenden Katalog der anfechtbaren Verfügungen enthalte, könne, so das Bundesgericht, eine Anbieterin auch nicht die Ausschreibungsunterlagen anfechten – zumal diese gerade nicht Bestandteil des genannten Katalogs bildeten (E. 3.3.1). Beanstandungen von allfälligen Mängeln in den Ausschreibungsunterlagen könnten im Einladungsverfahren erst im Rechtsmittel gegen das nächste zulässige Beschwerdeobjekt vorgetragen werden (E. 3.3.2).
Ergebnis
Im Ergebnis habe die Vorinstanz zu Unrecht die Rüge der zu tiefen Gewichtung des Zuschlagskriteriums “Preis” nicht zugelassen und nicht geprüft. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erweise sich in diesem Punkt als begründet. Die Prüfung der Rüge der unrechtmässigen Gewichtung der Zuschlagskriterien habe die Vorinstanz in einem zweiten Rechtsgang vorzunehmen, wozu die Angelegenheit an die Vorinstanz zurückzuweisen sei (E. 3.5).
5A_112/2025, 5A_363/2025: Öffentliche Versteigerung von Grundstücken zur Teilung des Miteigentums (Art. 651 Abs. 2 ZGB)
5A_112/2025, 5A_363/2025: Öffentliche Versteigerung von Grundstücken zur Teilung des Miteigentums (Art. 651 Abs. 2 ZGB)
von Jamie Lee Mancini am 23. Oktober 2025
Im Entscheid 5A_112/2025, 5A_363/2025 vom 11. September 2025 behandelt das Bundesgericht die Frage nach der Zulässigkeit der Anordnung einer öffentlichen Versteigerung zwecks Auflösung des Miteigentums nach Art. 651 Abs. 2 ZGB.
Sachverhalt
Die A. AG, B. und die C. AG waren Miteigentümerinnen vier unbebauter Grundstücke. Die Beschwerdeführer A. AG und B. hielten je einen Viertel des Miteigentums, die C. AG die Hälfte des Miteigentums. Im März 2022 klagte die C. AG gegen die A. AG und B. auf Aufhebung des Miteigentums. Sie beantragte die öffentliche Versteigerung der Grundstücke gemäss Art. 651 Abs. 2 ZGB und die Verteilung des Steigerungserlöses nach Massgabe der jeweiligen Miteigentumsanteile. Die Klage wurde gutgeheissen, wogegen die Beschwerdeführer Berufung und schliesslich – nach deren Abweisung – Beschwerde beim Bundesgericht erhoben.
Beurteilung
Anlass zur Beschwerde gab die öffentliche Versteigerung von vier Grundstücken, wie sie die Vorinstanz im Rahmen der Teilung von Miteigentum nach Art. 651 Abs. 2 ZGB angeordnet und dem Betreibungsamt übertragen hatte. Die Beschwerdeführer warfen der Vorinstanz zusammengefasst vor, sie hätte statt einer öffentlichen Versteigerung eine Versteigerung unter den Miteigentümern anordnen müssen und – schliesslich – die Möglichkeit einer Realteilung zu Unrecht verworfen (E. 3.1).
Das Bundesgericht hielt den Anspruch eines jeden Miteigentümers fest, die Aufhebung des Miteigentums zu verlangen (Art. 650 Abs. 1 ZGB). Als Teilungsart sehe das Gesetz die körperliche Teilung der Sache oder, wenn dies ohne wesentliche Verminderung ihres Wertes nicht möglich sei, die Versteigerung – öffentlich oder unter den Miteigentümern – vor (Art. 651 Abs. 2 ZGB). Das Gericht entscheide über die Teilungsart aufgrund sämtlicher Sachumstände des konkreten Einzelfalls nach Billigkeit (Art. 4 ZGB). Es sei frei, das Miteigentum an der Sache durch deren körperliche Teilung oder durch Versteigerung aufzuheben (BGE 149 III 165 E. 3.2). Die körperliche Teilung beanspruche keinen absoluten Vorrang, selbst wenn sie ohne Wertverlust möglich sei (E. 3.2 mit Hinweis auf BGE 100 II 187 E. 2e).
Das Bundesgericht stützte die Argumentation der Vorinstanz, wonach Versteigerungen unter den Miteigentümern eher bei Familienkonstellationen in Frage kämen, während in Konstellationen, bei welchen die Erzielung des grösstmöglichen Gewinnes im Vordergrund stünde, eher öffentliche Versteigerungen anzuordnen seien. Vorliegend sei letztgenanntes Szenario der Fall: Bei den Parteien handle es sich um gewinnorientierte Immobilienunternehmen bzw. den in der Immobilienbranche tätigen Beschwerdeführer B. Die Anordnung der öffentlichen Versteigerung liege daher, so das Bundesgericht, im Ermessen der Vorinstanz. Dass namentlich der Beschwerdeführer B. seinen Miteigentumsanteil von seiner Mutter geerbt habe, vermöge daran nichts zu ändern (E. 4.2).
Dass die Vorinstanz zu Unrecht auf den Eventualantrag der Realteilung nicht eingetreten sei, wies das Bundesgericht ebenfalls zurück: Da sich die künftige Überbauung der vier Grundstücke nach einem öffentlich-rechtlich verbindlichen Quartierplan richtete, hätten die Nebenfolgen einer Realteilung (namentlich die Errichtung von Dienstbarkeiten) hinreichend bestimmt beantragt werden müssen. Dies hätten die Beschwerdeführer, so das Bundesgericht, unterlassen, womit die Vorinstanz zu Recht einen Anspruch auf körperliche Teilung verneint habe (E. 5.3).
Ergebnis
Schliesslich bestätigte das Bundesgericht auch die von der Vorinstanz angewandten Steigerungsbedingungen (E. 6.3) sowie die festgesetzte Entscheidgebühr (E. 7.3.3) und wies die Beschwerde ab.
4A_282/2024: Prüfung der Voraussetzungen nach Art. 260 SchKG und Aktenschluss (amtl. Publ.; Franz.)
4A_282/2024: Prüfung der Voraussetzungen nach Art. 260 SchKG und Aktenschluss (amtl. Publ.; Franz.)
von Stéphanie Oneyser am 15. Oktober 2025
In diesem zur Publikation vorgesehenen Entscheid 4A_282/2024 vom 7. Mai 2025 setzte sich das Bundesgericht mit der Frage auseinander, ob neue Tatsachen und Beweismittel im Zusammenhang mit den Voraussetzungen nach Art. 260 SchKG vor dem Berufungsgericht vorgebracht werden dürfen und inwiefern das Gericht verpflichtet ist, den Sachverhalt im Zusammenhang mit den Prozessvoraussetzungen zu ermitteln. Es kam zum Schluss, dass die Nachreichung der Rückseite der Abtretungsverfügung erst mit der Berufungsantwort ein unzulässiges Novum darstellt, und dass die Erstinstanz nicht verpflichtet gewesen wäre, den anwaltlich vertretenen Kläger auf die fehlende Rückseite aufmerksam zu machen, da der Beklagte diesen Umstand noch vor der Hauptverhandlung moniert hatte und die unvollständige Urkunde die Beweisofferte des Klägers darstellt, die im Rahmen der Beweiswürdigung zu beurteilen ist, was eine Anwendung von Art. 56 ZPO ausschliesst.
Dem Entscheid lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Kläger hatte als Prozessstandschafter der Konkursmasse der C SA Klage gegen den Beklagten vor dem Bezirksgericht Sitten erhoben. Er machte geltend, dass ihm die Rechte zur Prozessführung gemäss Art. 260 SchKG abgetreten worden seien, und reichte lediglich die Vorderseite der Abtretungsverfügung (die in der Form eines Formulars erlassen wurde) ein. Der Beklagte beantragte daraufhin beim Bezirksgericht, auf die Klage nicht einzutreten. Mit Urteil vom 28. August 2020 hiess das Bezirksgericht Sitten die Klage des Klägers gut und verpflichtete den Beklagten, CHF 100’000 zzgl. Zins zu 5% seit dem 12. Januar 2016 zu bezahlen. Dagegen erhob der Beklagte Berufung beim Walliser Kantonsgericht, welche mit Urteil vom 30. November 2020 abgewiesen wurde. Im Rahmen des Berufungsverfahrens vor dem Kantonsgericht reichte der Kläger die Rückseite der Abtretungsverfügung nach. Obwohl das Kantonsgericht der Ansicht war, dass die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht vorlägen, erachtete es die nachgereichte Rückseite der Abtretungsverfügung aufgrund des Verbots des überspitzten Formalismus als zulässig. Aufgrund der schlechten Qualität der Kopie und der fehlenden Rückseite hätte das Bezirksgericht dem Kläger die Gelegenheit geben müssen, diese Beilage zu vervollständigen.
Mit Eingabe vom 13. Mai 2024 erhob der Beklagte Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht. Mit Urteil vom 7. Mai 2025 hiess das Bundesgericht die Beschwerde gut und wies die Sache zur Neuregelung der kantonalen Kosten- und Entschädigungsfolgen an die Vorinstanz zurück.
Die Prozessstandschaft nach Art. 260 SchKG als Prozessvoraussetzung
Das Bundesgericht erwog zunächst, dass die Prozessstandschaft nach Art. 260 SchKG eine Prozessvoraussetzung darstellt, die gemäss Art. 60 ZPO von Amtes wegen zu prüfen ist (E. 3.1.1).
Prüfung der Prozessvoraussetzungen und Novenschrank
Sodann erwog das Bundesgericht, dass die Prozessvoraussetzungen gemäss Art. 60 ZPO von Amtes wegen zu prüfen sind, selbst bei der Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Im Rahmen dieser Prüfung müssen daher Noven bis zur Urteilsberatung berücksichtigt werden (Art. 229 Abs. 3 ZPO). Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Gericht die Sachverhaltselemente selbst suchen muss, welche das Vorliegen der Prozessvoraussetzungen belegen. Im Gegenteil enthebt es die Parteien nicht davon, an der Sammlung des Prozessstoffes aktiv mitzuwirken und dem Gericht das in Betracht fallende Tatsachenmaterial zu unterbreiten und die Beweismittel zu bezeichnen (E. 3.1.2).
Das Gericht hat nur dann von Amtes wegen Abklärungen vorzunehmen, wenn die Gefahr besteht, dass ein Sachurteil trotz Fehlen einer Prozessvoraussetzung ergeht. Die Pflicht, den Tatsachen nachzugehen oder diese von Amtes wegen zu berücksichtigen, betrifft also lediglich Umstände, welche die Zulässigkeit der Klage hindern und ein Nichteintreten begründen können. Das Gericht ist allerdings nicht zu ausgedehnten Nachforschungen verpflichtet. Vor diesem Hintergrund sind Noven, die sich auf einen die Zulässigkeit der Klage bejahenden Umstand beziehen, unzulässig und können nur im Rahmen von Art. 317 Abs. 1 ZPO berücksichtig werden. Dies gilt auch für den neuen Art. 317 Abs. 1bis ZPO (der am 1. Januar 2025 in Kraft getreten ist) (E. 3.1.2).
Die Bedeutung von Art. 56 ZPO
In der Folge setzte sich das Bundesgericht mit der Frage auseinander, ob die Erstinstanz nach Art. 56 ZPO verpflichtet gewesen wäre, den Kläger auf die fehlende Rückseite aufmerksam zu machen. Dabei rief es seine Rechtsprechung zu Art. 56 ZPO in Erinnerung. Der Zweckgedanke der allgemeinen gerichtlichen Fragepflicht nach Art. 56 ZPO besteht darin, dass eine Partei nicht wegen Unbeholfenheit ihres Rechts verlustig gehen soll, indem der Richter bei klaren Mängeln der Parteivorbringen helfend eingreifen soll. Die Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht darf keine Partei einseitig bevorzugen und nicht zu einer Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Parteien führen. Vor allem dient die gerichtliche Fragepflicht nicht dazu, prozessuale Nachlässigkeiten der Parteien auszugleichen. Bei anwaltlich vertretenen Parteien hat die richterliche Fragepflicht nur eine sehr eingeschränkte Tragweite. Die gerichtliche Fragepflicht wird nur ausgelöst, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen nach Art. 56 ZPO gegeben sind, mithin ein unklares, widersprüchliches, unbestimmtes oder offensichtlich unvollständiges Parteivorbringen vorliegt.Die gerichtliche Fragepflicht trägt dem Richter freilich nicht auf, einer Partei bei der Beweisführung behilflich zu sein. Die Beurteilung der Beweiskraft eines eingereichten Beweismittels bildet Beweiswürdigung und kann daher nicht Gegenstand der gerichtlichen Fragepflicht sein (E. 3.1.3).
Im konkreten Fall hatte die Vorinstanz festgestellt, dass der Beklagte die Prozessstandschaft des Klägers in seiner Klageantwort vom 22. Mai 2018 bestritten hatte und in einer Eingabe vom 27. Dezember 2018 — also noch vor der Urteilsberatung — darauf aufmerksam gemacht hatte, dass die Abtretungsverfügung unvollständig ist (E. 3.2).
Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass die Vorinstanz diese Grundsätze missachtet hat, indem sie die Nachreichung der Rückseite als zulässig erklärte. Da es sich bei der Abtretungsverfügung um einen die Zulässigkeit der Klage begründenen Umstand handelt, musste diese Frage nicht von Amtes wegen geklärt werden. Ferner stellt es eine weitere prozessuale Nachlässigkeit dar, dass der anwaltlich vertretene Kläger die Rückseite nicht vor der Urteilsberatung nachgereicht hat, nachdem er vom Beklagten darauf aufmerksam gemacht wurde. Schliesslich stellt die unvollständige Urkunde die Beweisofferte des Klägers für seine Behauptungen dar, die das Gericht im Rahmen der Beweiswürdigung zu beurteilen hat. Vor diesem Hintergrund erwog das Bundesgericht, dass die Erstinstanz nicht verpflichtet gewesen wäre, ihre richterliche Fragepflicht auszuüben (E. 3.3):
“La cour cantonale a méconnu que la maxime inquisitoire simple régissant l’établissement des faits nécessaires pour juger des conditions de recevabilité de la demande, n’oblige le tribunal à tenir compte d’office que des circonstances qui font obstacle à la recevabilité de la demande et peuvent justifier une non-entrée en matière. Or, la preuve du fait que le demandeur s’était vu céder les droits de la masse en faillite était une circonstance accréditant la recevabilité de la demande et non y faisant obstacle. Le juge de première instance n’avait donc pas à établir les faits d’office sur ce point.
De plus, lorsqu’il interpelle la partie en vertu de l’art. 56 CPC, le juge doit veiller à ne pas avantager unilatéralement une partie. Il doit en particulier intervenir pour éviter qu’une partie ne perde son droit par inexpérience, mais pas pour corriger les négligences procédurales graves d’une partie, a fortiori représentée par un avocat. Or, outre “l’erreur de photocopieuse” qui constitue déjà une première négligence, l’omission pour la partie représentée par un avocat, de compléter la pièce mal photocopiée, alors que son attention a été attirée sur ce défaut par le défendeur et qu’un laps de temps d’un an et demi s’est encore écoulé avant le début de la phase de délibération, constitue assurément une négligence procédurale, que le juge ne saurait corriger sans avantager la partie demanderesse. La cour cantonale ne pouvait donc pas considérer que le juge de première instance avait le devoir d’interpeller le demandeur, sans violer les conditions de l’art. 56 CPC.
Enfin, dans la mesure où la partie demanderesse a allégué s’être fait céder les droits de la masse en faillite et a offert à titre de preuve le formulaire n° 7F, censé attester de cette cession, l’allégué et l’offre de preuve étaient complets. Le juge n’a donc plus matière à interpeller la partie sur ces points. Constater que la preuve proposée est insuffisante et que, faute de comporter la date et la signature de l’office des faillites, elle ne permet pas de prouver que les droits de la masse en faillite ont effectivement été cédés au demandeur, ressortit à l’appréciation de la force probante du moyen de preuve offert. Celle-ci ne fait pas l’objet du devoir d’interpellation du juge, qui ne porte que sur l’allégué et l’offre de preuve.
Par conséquent, le juge de première instance n’avait pas à interpeller le demandeur sur le fait que le moyen de preuve produit n’était pas probant en vertu de l’art. 56 CPC. (…)”
1C_730/2024: Beschwerdelegitimation des Schweizer Heimatschutzes (Fall Luxram-Gebäude)
1C_730/2024: Beschwerdelegitimation des Schweizer Heimatschutzes (Fall Luxram-Gebäude)
von Jamie Lee Mancini am 10. Oktober 2025
Im Entscheid 1C_730/2024 vom 1. Setember 2025 behandelte das Bundesgericht die Zulässigkeit der Verbandsbeschwerde des Heimatschutzes im Zusammenhang mit dem geplanten Abbruch des sog. «Luxram-Gebäudes» in Arth.
Der Beschwerdegegner A. reichte beim Gemeinderat ein Beugesuch für den Abbruch des Luxram-Gebäudes ein, welches mit Gesamtentscheid vom 26. Januar 2025 und Beschluss der Gemeinde Arth vom 2. April 2024 gutgeheissen wurde. Rund ein Jahr zuvor hatte der Regierungsrat die Schutzwürdigkeit des Gebäudes abgeklärt und auf eine Aufnahme in das Kantonale Schutzinventar (KSI) verzichtet. Auf die Einsprachen vom Schweizer und Schwyzer Heimatschutz ist die Gemeinde mangels Beschwerdelegitimation nicht eingetreten. Sowohl der Regierungsrat als auch das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz wiesen ihre Beschwerden gegen die erteilte Abbruchbewilligung ebenfalls ab. Der Schweizer Heimatschutz gelangte sodann mit Beschwerde an das Bundesgericht.
Streitgegenstand vor Bundesgericht bildete einzig die Beschwerdelegitimation des Schweizer Heimatschutzes bzw. die Zulässigkeit des Nichteintretens auf seine Einsprache bei der Gemeinde Arth.
Das Bundesgericht hielt fest, dass es sich beim Schweizer Heimatschutz zu den vom Bundesrat als beschwerdeberechtigt bezeichneten Organisationen handelt, denen das Verbandsbeschwerderecht nach Art. 12 NHG zustehe. Nach ständiger Rechtsprechung stehe die Verbandsbeschwerde nach Art. 12 NHG nur offen, soweit der angefochtene Entscheid die Erfüllung einer Bundesaufgabe im Sinne von Art. 78 Abs. 2 BV und Art. 2 NHG. Voraussetzung hierfür sei in erster Linie, dass die angefochtene Verfügung eine Rechtsmaterie betreffe, die in die Zuständigkeit des Bundes falle und bundesrechtlich geregelt sei, wobei das betreffende Bundesrecht hinreichend detailliert und direkt anwendbar sein müsse (E. 3.3.2).
Eine solche Bundesaufgabe könne – wie vorliegend vom Beschwerdeführer geltend gemacht wurde – im Bereich des Gewässerschutzes bestehen. Dies sei, so das Bundesgericht, u.a. dann der Fall, wenn eine Baute in einem Gewässerschutzbereich Au unterhalb des mittleren Grundwasserspiegels erstellt werden solle und deshalb auf eine Ausnahmebewilligung nach Art. 19 Abs. 2 GSchG i.V.m. Ziff. 211 Abs. 2 Anhang 4 GSchV angewiesen sei (E. 3.3.1). Dieser Anwendungsfall – bei dem das Bundesgericht mehrfach bereits das Vorliegen einer Bundesaufgabe bestätigt hatte – liege in casu aber nicht vor. Vielmehr sei eine Bewilligung nach Art. 32 Abs. 2 GSchV (eine Bewilligung für Anlagen und Tätigkeiten in den besonders gefährdeten Bereichen) erforderlich.
Ob ein hinreichender Bezug zwischen einer gewässerschutzrechtlichen Bewilligung nach Art. 19 Abs. 2 GSchG i.V.m. Art. 32 Abs. 2 GSchV und dem Natur- und Heimatschutz besteht, um als Bundesaufgabe im Sinne von Art. 78 Abs. 2 BV und Art. 2 NHG zu gelten, war bisher nicht durch das Bundesgericht geklärt worden. Die Bewilligung nach Art. 32 Abs. 2 GSchV– so das Bundesgericht vorliegend – habe ihre Grundlage aber wie die erwähnte Ausnahmebewilligung nach Ziff. 211 Abs. 2 Anhang 4 GSchV in Art. 19 Abs. 2 GSchG. Dass sich die beiden Bewilligungen mit Blick auf die Anforderungen an deren Erteilung unterschieden (Polizeierlaubnis bzw. Ausnahmebewilligung), trete hinter den Umstand zurück, dass sie letztlich beide den Schutz des Grundwassers vor möglichen Gefährdungen bezweckten (vgl. Art. 19 Abs. 2 GSchG). Somit müsse auch für die Bewilligung nach Art. 32 Abs. 2 GSchV dasselbe gelten, wie für die Ausnahmebewilligung nach Ziff. 211 Abs. 2 Anhang 4 GSchV (E. 3.3.4). Es sei somit von einer Bundesaufgabe auszugehen, wenn für ein Bauprojekt im Gewässerschutzbereich Au ohne Unterschreitung des mittleren Grundwasserspiegels eine Bewilligung nach Art. 19 Abs. 2 GSchG i.V.m. Art. 32 Abs. 2 GSchV erforderlich sei (E. 3.3.5).
Die Notwendigkeit einer solchen Bewilligung sei vorliegend noch nicht geprüft worden, zumal die Vorbringen des Heimatschutzes im vorinstanzlichen Verfahren materiell-rechtlich unberücksichtigt geblieben sind. Die Beschwerde wurde folglich gutgeheissen und die Sache im Sinne der Erwägungen zur Fortsetzung des Verfahrens an die Vorinstanz zurückgewiesen.
SSG 2024/DO/22: Reduktion der Dopingsperre gegen einen Freizeitsportler
SSG 2024/DO/22: Reduktion der Dopingsperre gegen einen Freizeitsportler
von Olivia Curiger am 9. Oktober 2025
Im Entscheid SSG 2024/DO/22 reduzierte das Schweizer Sportgericht die von Swiss Sport Integrity (“SSI”) beantragte Sperre gegen einen Freizeitsportler von vier Jahren auf ein Jahr.
Das Dopingverfahren wurde von SSI aufgrund einer Information der Zollstelle Zoll Nord eingeleitet, wonach ein Paket mit dem Inhalt von 180 RAD140 à 10mg von Best Supps LTD an den Freizeitsportler adressiert war. Der Inhalt des Pakets wurde im verwaltungsrechtlichen Verfahren eingezogen und vernichtet (Rz. 24 f.).
Die Anklage von SSI enthielt den Vorwurf der versuchten Anwendung der verbotenen Substanz RAD140 gemäss Art. 2.2 Doping-Statut sowie den Vorwurf des Besitzes der verbotenen Substanz RAD140 gemäss Art. 2.6 Doping-Statut (Rz. 22 f.).
Das Schweizer Sportgericht stellte zunächst fest, dass es sich bei der angeschuldigten Person unbestritten um einen Freizeitsportler im Sinne des Doping-Statuts handle und dass RAD140 eine nicht-spezifische Substanz im Sinne von Art. 4.2.4 Doping-Statut i.V.m. S. 3 und S. 5 Dopingliste sei (Rz. 117).
Zum Vorwurf der versuchten Anwendung führte das Schweizer Sportgericht aus, dass ein “Versuch” gemäss Doping-Statut ein vorsätzliches Verhalten voraussetzte, “das einen wesentlichen Schritt im geplanten Verlauf einer Handlung darstellt, die auf einen Verstoss gegen Anti-Doping-Bestimmungen abzielt. […]”. Da SSI nach Art. 3.1.1 Doping-Statut die Beweislast für Verstösse gegen die Anti-Doping-Bestimmungen trage, habe SSI auch den Vorsatz der angeschuldigten Person zu beweisen. Vorliegend sei dieser Nachweis nicht erbracht worden, womit der Tatbestand der versuchten Anwendung nicht erfüllt sei (Rz. 84 ff.).
Hingegen erachtete das Schweizer Sportgericht den Tatbestand des Besitzes gemäss Art. 2.6 Doping-Statut als gegeben. Es stützte sich dabei auf die Definition des Besitzes gemäss Anhang des Doping-Statuts, wonach bereits der “Kauf (auch auf elektronischem und anderem Wege) einer verbotenen Substanz oder Methode als Besitz durch die Person, die den Kauf tätigt” gelte (Rz. 101 ff.).
Für Verstösse gegen Art. 2.1, 2.2 oder 2.6 Doping-Statut werden die in Art. 10.2 Doping-Statut aufgeführten Sperren verhängt, es sei denn, die Bedingungen für die Aufhebung oder Reduktion der Sperre nach Art. 10.5, 10.6 oder 10.7 Doping-Statut seien erfüllt (Rz. 110). Nach Art. 10.2.1 i.V.m. Art. 10.2.1.1 Doping-Statut sei unter Vorbehalt von Art. 10.2.4 Doping-Statut eine Sperre von vier Jahren vorgesehen, wenn der Verstoss gegen die Anti-Doping-Bestimmungen keine spezifische Substanz betreffe und die angeschuldigte Person nicht nachweisen könne, dass der Verstoss nicht vorsätzlich begangen worden sei (Rz. 111). Für den Nachweis, dass kein vorsätzliches Handeln vorliege, sei das Beweismass der Glaubhaftmachung erforderlich (Rz. 113).
Vorliegend berücksichtigte das Schweizer Sportgericht verschiedene von der angeschuldigten Person vorgebrachten Umstände, die gegen vorsätzliches Handeln sprachen, insbesondere das junge Alter und die geringe Erfahrung der angeschuldigten Person, die Bestellung des Produkts über die Website eines österreichischen Onlinehändlers, die positive Vermarktung von Nahrungsergänzungsmitteln in den sozialen Medien, den positiven Produktbeschrieb ohne direkte Warnhinweise oder Risikoinformationen sowie das Nichtbewusstsein der angeschuldigten Person, dass es sich bei dem Produkt um eine verbotene Substanz handle und dass eine solche Substanz über einen regulären Onlinehändler bezogen werden könne.
Gestützt auf diese Umstände kam das Schweizer Sportgericht zum Schluss, dass die angeschuldigte Person nicht vorsätzlich gehandelt habe. Es hielt jedoch auch fest, dass ihr vorzuhalten sei, dass sie ein Produkt bestellt habe, ohne genau zu wissen, um was für ein Produkt und mit welchen Inhaltsstoffen es sich gehandelt habe. Aufgrund der Produktbeschreibung des bestellten Produktes hätte eine sorgfältig handelnde Person Abklärungen zur Substanz RAD140 vorgenommen und mit einer einfachen Suchanfrage im Internet in Erfahrung gebracht, dass es sich um eine verbotene Dopingsubstanz handle. Entsprechend sei das Verhalten der angeschuldigten Person näher bei einem grobfahrlässigen Verhalten als bei keiner Fahrlässigkeit (Rz. 129 ff.).
Angesichts der Schwere des Verschuldens erachtete das Schweizer Sportgericht eine Sperre von einem Jahr als angemessene Sanktion. Die Verfahrenskosten von CHF 500.00 wurden vollumfänglich der angeschuldigten Partei auferlegt und ihr wurde trotz der erheblichen Reduktion der Sperre keine Parteientschädigung zugesprochen (Rz. 165 ff.). Auf das Wiedererwägungsgesuch der angeschuldigten Person, das sich gegen die Verteilung der Verfahrenskosten und die Verweigerung einer Parteientschädigung richtete, trat das Schweizer Sportgericht nicht ein.
Hinweis: Die angeschuldigte Person wurde von der Autorin dieses Beitrags vertreten.
III 2025 33 VGer SZ: Widersprüche bei Ausschreibungen und Ausschreibungsunterlagen (Submissionsrecht)
III 2025 33 VGer SZ: Widersprüche bei Ausschreibungen und Ausschreibungsunterlagen (Submissionsrecht)
von Jamie Lee Mancini am 23. September 2025
Im Entscheid III 2025 33 vom 31. Juli 2025 des Schwyzer Verwaltungsgerichts äussert sich dieses zur Frage, wie Widersprüche zwischen der Ausschreibung auf der Beschaffungsplattform ’simap’ und den Ausschreibungsunterlagen aufzulösen sind.
Sachverhalt
Am 19. November 2024 schrieb die Gemeinde Wollerau auf der Beschaffungsplattform ’simap’ den Auftrag “Heizungsersatz Gemeinde Wollerau — BKP 240 Heizungsinstallationen” im offenen Verfahren aus. Die Ausschreibung statuierte, dass Varianten nicht zugelassen seien. Davon abweichend wurde in den detaillierten Ausschreibungsunterlagen festgehalten, dass Varianten bei gleichzeitiger Eingabe des Grundangebotes ohne Veränderungen an demselben zugelassen seien.
Nachdem die Beschwerdeführerin den Zuschlag (basierend auf ihrem Grundangebot) nicht erhalten hatte, gelangte sie an das Verwaltungsgericht. Dieses untersuchte, wie bei Widersprüchen zwischen der Ausschreibung auf der Beschaffungsplattform ’simap’ und den Ausschreibungsunterlagen vorzugehen ist.
Rechtliches
Das Verwaltungsgericht hielt fest, dass Anbietervarianten immer zugelassen seien, sofern sie die Vergabestelle nicht explizit ausschliesse (E. 2.2). Im vorliegenden Fall sei relevant, dass die auf simap publizierte Ausschreibung Varianten explizit ausgeschlossen habe, während die Ausschreibungsunterlagen Varianten – an zwei Stellen – explizit zugelassen hätten (E. 2.5). Zwar habe das Waadtländer Verwaltungsgericht bei entsprechenden Unterschieden zwischen der Ausschreibung und den Ausschreibungsunterlagen der Ausschreibung den Vorrang zugesprochen (MPU.2018.0028 vom 1.4.2019 E. 4d), doch sei dieser ausserkantonale Entscheid vorliegend nicht bindend. Er fusse zudem auf einem abweichenden Sachverhalt, bei dem sich – anders als vorliegend – nur die Ausschreibung zur Zulässigkeit von Varianten geäussert habe, die Ausschreibungsunterlagen hingegen gar nicht (E. 2.6).
Entscheidend für die Priorisierung widersprüchlicher Informationen von Ausschreibungen und Ausschreibungsunterlagen sei, so das Verwaltungsgericht, deren unterschiedlicher Zweck: Die Ausschreibung auf der Beschaffungsplattform simap diene als Kurzinformation für die Anbieterinnen um entscheiden zu können, ob sie ein Angebot einreichen oder nicht. In den Ausschreibungsunterlagen werde sodann der Beschaffungsgegenstand ausführlich en detail umschrieben, so dass eine sachgerechte Offerte ausgearbeitet und eingereicht werden könne. Die Offertstellung basiere letztlich auf den Ausschreibungsunterlagen und nicht der Ausschreibung. Vorliegend könne der Widerspruch zwischen Ausschreibung und Ausschreibungsunterlage somit derart aufgelöst werden, dass die in den Ausschreibungsunterlagen festgelegte Information gelte und Anbietervarianten im Ergebnis zugelassen seien (E. 2.6).
Zumal die Unternehmervariante der Beschwerdeführerin weder Eingang in das Offertöffnungsprotokoll fand noch im Vergabebeschluss erwähnt wurde, war der Zuschlag aufzuheben und die Sache zur ordentlichen Prüfung aller eingegangenen Offerten an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beschwerde wurde gutgeheissen.
1C_635/2024: Baubewilligung | Würdigung unterschiedlicher Gutachten bei Einordnungsfragen
1C_635/2024: Baubewilligung | Würdigung unterschiedlicher Gutachten bei Einordnungsfragen
von Jamie Lee Mancini am 17. September 2025
Im Entscheid 1C_635/2024 setzt sich das Bundesgericht mit der Frage auseinander, welche Bedeutung im Ergebnis verschiedener Gutachten bei der Beurteilung der Bewilligungsfähigkeit eines Bauvorhabens zuzumessen ist.
Die Beschwerdeführerin ist Eigentümerin eines Grundstücks in Paspels, Gemeinde Domleschg (GR), welches innerhalb eines im ISOS- und BLN-Inventar verzeichneten Objekts liegt. Im Juni 2022 reichte die Beschwerdeführerin ein Baugesuch für den Bau eines Mehrfamilienhauses ein. Die Beschwerdegegner (Eigentümer der Nachbarparzelle) erhoben Einsprache gegen das Bauvorhaben, welche mit Entscheid der Baukommission der Gemeinde Domleschg abgewiesen wurde. Das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden hob die Baubewilligung wiederum auf. Hiergegen gelangte die Beschwerdeführerin an das Bundesgericht.
Das Bundesgericht äusserte sich im Wesentlichen zur Frage, wie die Vorinstanz mit im Ergebnis unterschiedlichen Gutachten zur Einordnung des Bauvorhabens bzw. potenziellen Eingriffen in das betroffene ISOS-Objekt umzugehen hatte. Es standen sich eine Stellungnahme der Bauberaterin der Gemeinde Domleschg, ein Bericht, der von den Beschwerdegegnern in Auftrag gegeben worden war, und ein von der Vorinstanz eingeholter Amtsbericht der kantonalen Denkmalpflege gegenüber.
Das Bundesgericht wies darauf hin, dass letztinstanzliche kantonale Gerichte den Sachverhalt frei zu prüfen und das massgebende Recht von Amtes wegen anzuwenden haben (Art. 110 BGG). Als Ausfluss des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) – der im Sinne eines Mitwirkungsrechts ebenfalls der Sachverhaltsaufklärung diene – habe sich die kantonal zuständige Instanz auch mit den Vorbringen und Beweismitteln der Parteien auseinanderzusetzen (E. 3.1). Vorliegend komme es, so das Bundesgericht, weder darauf an, ob die Vorinstanz die Stellungnahme der Bauberaterin und den Bericht der von der Beschwerdegegnerschaft beigezogenen Expertin “gleichgesetzt” habe, noch sei massgeblich, welche objektive Beweiskraft sie diesen Dokumenten beigemessen habe. Selbst wenn man nämlich dem Bericht der kommunalen Bauberaterin eine höhere Beweiskraft zuerkennen wollte als der Einschätzung des von der Beschwerdegegnerschaft privat mandatierten Beratungsbüros, ändere dies nichts daran, dass letztere geeignet sein könne, Zweifel an der Schlüssigkeit des ersteren aufkommen zu lassen (vgl. Urteil 1C_526/2015 vom 12. Oktober 2016 E. 6.5 mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 142 II 517). Das Bundesgericht stellt somit klar, dass einem Parteigutachten nicht per se eine tiefere Beweiskraft als einem Gutachten einer Bauberaterin zuzumessen ist, sondern sämtliche Beweismittel einer neutralen Überprüfung und Würdigung unterliegen. Verfüge die Vorinstanz zur Beurteilung der sich dabei stellenden Tatfragen nicht selbst über das notwendige Fachwissen, sei, so das Bundesgericht weiter, nicht zu beanstanden, wenn sie sich dieses mit der Einholung eines (zusätzlichen) Amtsberichts verschaffe (E. 3.2).
Schliesslich begründe die selbständige Einholung eines Amtsberichts durch die Vorinstanz weder eine Verletzung der Gemeindeautonomie noch einen Verstoss gegen das Willkürverbot: Wie erwähnt, sei es gerade die Pflicht der Vorinstanz, den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen und die Beweismittel frei zu würdigen. Dazu gehöre auch, bei Zweifeln an der Schlüssigkeit des von der Gemeinde eingeholten Fachberichts zusätzlich einen Amtsbericht einzuholen. Eine gegenteilige Auffassung liefe im Ergebnis darauf hinaus, dass es den kantonalen Gerichten verwehrt bliebe, in geschützten Autonomiebereichen eine freie Sachverhaltskontrolle und Beweiswürdigung vorzunehmen, was von Bundesrechts wegen nicht angehe (E. 4.5).
Das Bundesgericht wies die Beschwerde ab.